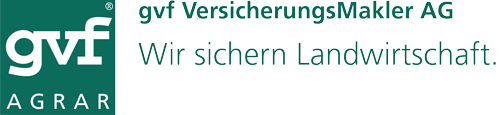Wissenschaftler sehen in Smart Farming einen wichtigen Schritt für kleinere Betriebe, wettbewerbsfähig zu bleiben.
- Projekt der Universität Hohenheim
- Mehr Tierwohl durch Digitalisierung
- Smart Farming im Stall
- Pflanzenbau mit Drohnen und Robotern
Ein Forscherteam unter der Koordination der Universität Hohenheim untersuchte das Potential von „Smart Farming“ – also die Anwendung digitaler Lösungen – gerade für kleine und mittelständische Agrarbetriebe. Die Möglichkeiten sind vielfältig: Drohnen über dem Feld erkennen frühzeitig Pflanzenkrankheiten, autonome Roboter setzen junge Gemüsepflanzen, und Künstliche Intelligenz hilft bei der Berechnung des Futterbedarfs von Weiderindern. Da viele Großbetriebe im In- und Ausland auf Landwirtschaft 4.0 setzen, sehen die Wissenschaftler eine Wettbewerbsverzerrung kleinerer Betriebe gegenüber. Digitalisierung soll laut den Forschern die Wettbewerbsfähigkeit steigern.
Mehr Tierwohl durch Digitalisierung
Nachhaltiger Anbau, regionale Futtermittel, hochwertige Lebensmittel und ein ethisch vertretbarer Lebensraum für Nutztiere: Die gesellschaftlichen Ansprüche an Tierwohl und Nachhaltigkeit steigen und werden immer komplexer. Doch „der weit verbreitete Wunsch, Rindern und anderen Nutztieren mehr Weidegang zu gewähren, hat auch seine Tücken“, weiß Prof. Eva Gallmann vom Zentrum für Tierhaltungstechnik an der Universität Hohenheim. „Unsere heutigen Kühe sind Hochleistungskühe, die eine bedarfs- und leistungsgerechte Futterversorgung brauchen“, erklärt die Wissenschaftlerin.
Smart Farming im Stall
Laut der Expertin haben Landwirte mithilfe digitaler Technik eine wesentlich bessere Kontrolle darüber, von welchem Futter wie viel fressen. „Eine Unterversorgung führt zu Krankheiten und schlechterer Milchleistung. Eine Überversorgung hingegen zieht neben den höheren betriebswirtschaftlichen Kosten auch eine erhöhte Umweltbelastung nach sich, da ein Teil der Nährstoffe des Futters ungenutzt wieder ausgeschieden wird, erklärt Gallmann. Deshalb sei es bei Weidetieren besonders wichtig, die Menge und Qualität des gefressenen Grünfutters zu kennen. Nur dann sei eine bedarfsgerechte Zufütterung möglich. So können laut der Expertin beispielsweise mit einem Instrument, das mit Nahinfrarotspektroskopie (NIRS) arbeitet, genaue Aussagen über die Qualität des Grünfutters gemacht werden. „Bislang wurde dieses Gerät ausschließlich im Labor eingesetzt, die Verwendung im Freiland ist recht neu“, weiß die Forscherin. Sie hält aber fest: „Auch modernste Technik kann das persönliche Engagement der Landwirt:innen für ihre Tiere nicht ersetzen!“
Effizienter Pflanzenschutz mit optischen Sensoren auf Drohnen
Möglichkeiten zur Steigerung der Effizienz bei der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln bieten Drohnen. Zum einen können Krankheiten bei Feldgemüse frühzeitig erkannt werden, zum anderen können Sensoren genau ermitteln, welche Mengen an Pflanzenschutzmitteln gegen Erkrankungen und Schädlinge überhaupt notwendig sind. Verhältnismäßig neu ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Landwirtschaft. Sie analysiert die Daten und ermöglicht den Einsatz von Mitteln zur Bekämpfung von Schadinsekten oder Spinnmilben. Diese können mit Hilfe von Sprüh-Drohnen gezielt an den befallenen Pflanzen eingesetzt werden. „Hier liegt aber auch die Herausforderung“, beschreibt Prof. Christian Trautmann von der Uni Hohenheim. „Denn die KI muss für jede Kultur und jedes Schadbild individuell trainiert werden, damit sie befallene Pflanzen auch unter Praxisbedingungen zuverlässig erkennt. Dazu müssen Tausende von Trainingsdaten zuvor von Menschen ausgewertet und interpretiert werden.“
Intelligenter Roboter für bodenschonendes Pflanzen
Im Gemüseanbau zeigt sich auch die Stärke der Robotik. Der Multifunktionsroboter Phoenix der Universität Hohenheim hat sich schon in verschiedenen Projekten bewährt. Im Projekt DiWenkLa setzt er Weißkohl-Jungpflanzen in präzisen Abständen, ohne den Boden unnötig zu verdichten. Eine KI überwacht den gesamten Prozess und sorgt für optimale Ergebnisse. Nils Lüling vom Fachgebiet Künstliche Intelligenz in der Agrartechnik an der Universität Hohenheim erklärt: „Unser Ziel war es, eine autonome Lösung zu entwickeln. Durch eine KI-basierte Überwachung kann das Pflanzaggregat seine Arbeitsqualität, auch auf Feldern mit unterschiedlichen Bodenverhältnissen, konstant halten und auf Fehler reagieren.“
Trotz Digitalisierung landwirtschaftlicher Betriebe ist aber klar: Der Mensch ist unumgänglich, er muss die Technik leiten.