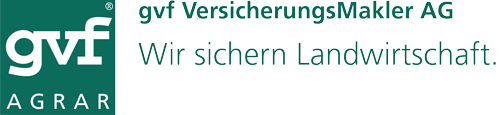Nach der Kritik von Verbänden, unter anderem dem Deutschen Bauernverband, am Vorgehen der Saatgut Treuhandverwaltungs GmbH veröffentlichte der Verband der Getreide-, Mühlen und Stärkewirtschaft ein Interview mit STV-Geschäftsführer Moritz von Köckritz.
- Rückmeldefrist Nachbauerklärung für Saatgut
- Zusammenfassung Interview Moritz von Köckritz
- Regelungen in anderen Ländern
Am 30. Juni 2025 endet die Rückmeldefrist für die Nachbauerklärung Herbst 2024/Frühjahr 2025 an die Saatgut Treuhandverwaltungs GmbH (STV). Die STV weist darauf hin, dass ein rechtmäßiger Nachbau nicht nur im Hinblick auf die dadurch begangene Sortenschutzverletzung rechtliche Folgen haben kann, sondern auch die Vermarktungsfähigkeit der Ernte gefährdet. Das Prozedere rund um die Meldevorgänge sorgte allerdings in jüngster Vergangenheit für Irritationen. 2023 hatte der Bundesgerichtshof (BGH) geurteilt, dass sich Landhändler vor der Abnahme von Getreide vergewissern müssen, ob ein Landwirt als Lieferant seine sortenschutzrechtlichen Verpflichtungen eingehalten hat. Der Deutsche Bauernverband (DBV) kritisierte unter anderem, dass die STV mutmaßlich Abmahnungen an Agrarhändler verschicke und diese und somit auch Landwirte in das sogenannte Erntegut-System der STV zwingen wolle. In einem Interview mit dem Verband der Getreide-, Mühlen und Stärkewirtschaft (VGMS) äußerte sich STV-Geschäftsführer Moritz von Köckritz und versuchte, Wind aus den Segeln zu nehmen.
Saatgut-Bescheinigung: Züchter setzen auf Dialog und Transparenz
Mit der Einführung der Erntegut-Bescheinigung (EBS) durch die STV stehen Agrarhändler und Mühlenbetriebe unter erheblichem Druck, die neue Regelung in der Landwirtschaft zu verankern. Um die Akzeptanz zu fördern, hätten der Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter (BDP) und die STV gezielt Maßnahmen ergriffen, wie von Köckritz erklärte: „Wir haben das System Erntegut-Bescheinigung (EBS) weiterentwickelt.“ Ziel sei es gewesen, Rückmeldungen aus der Praxis aufzugreifen und umzusetzen. So wurde das Verfahren laut von Köckritz deutlich vereinfacht, besonders für Verwender von Z-Saat- und Pflanzgut. Mittlerweile könne die Bescheinigung in weniger als 15 Minuten erstellt werden, verspricht der STV-Geschäftsführer.
Trotz technischer Verbesserungen bestehen weiterhin Vorbehalte, insbesondere seitens der Landwirte. Diese befürchten mehr Bürokratie. Von Köckritz sieht die Hauptursache hierfür in unzureichender Kommunikation. Auf Seiten der Landwirtschaft wird teilweise eine bürokratische Mehrbelastung befürchtet. Irreführende Informationen, etwa zur Pflicht, vollständige Flächenverzeichnisse hochzuladen, trügen laut von Köckritz zur Verunsicherung bei. Dabei sei das Hochladen von Nachweisen optional, und bei Bedarf könnten sensible Angaben geschwärzt werden. Der Züchterverband betont, dass es um den Erhalt der mittelständischen Züchtungslandschaft gehe: „Wenn Züchter vom Markt verschwinden, verschwinden auch Zuchtprogramme, gerade die von selbstbefruchtenden Kulturarten stehen auf dem Spiel.“
Ländervergleich und Forderung nach gesetzlicher Regelung
Ein Blick nach Europa zeigt unterschiedliche Wege im Umgang mit dem Nachbau. In Frankreich wird eine pauschale Nachbauabgabe bei der Erntegutanlieferung erhoben, in Finnland erfolgt die Angabe im Rahmen des Agrarförderantrags. In einigen Ländern existieren gemeinsame Systeme von Bauern- und Züchterverbänden. In Deutschland hingegen scheiterten bisher alle Versuche einer einheitlichen Branchenlösung.
Eine gesetzliche Neuregelung wäre nach Ansicht von Köckritzs sinnvoll, stößt jedoch auf strukturelle Hürden. Für den Erfolg einer Gesetzesänderung sei laut von Köckritz entscheidend, Einigkeit zwischen den betroffenen Verbänden herzustellen. Bis dahin bleibe es den Erfasserbetrieben überlassen, ob sie die EBS als Nachweis einsetzen. Diese biete jedoch einen entscheidenden Vorteil: Sie entlaste rechtlich, da bei Nutzung der EBS keine Ansprüche gegenüber dem Erfasser geltend gemacht würden. Einfache Eigenbestätigungen von Landwirten reichten dagegen nicht aus und würden rechtliche Risiken bergen, so von Köckritz. Klar sei: Die Branche braucht praktikable und rechtssichere Lösungen – gerade in der stressintensiven Erntezeit.